„Können wir bitte über die wichtigen Dinge sprechen?“ – mit diesem Satz bringt Patricia Rahemipour, Direktorin des Instituts für Museumsforschung, eine zentrale Frage auf den Punkt (tagesschau-Beitrag, 18.07.2025): Warum wird in öffentlichen Debatten immer wieder hinterfragt, ob Museen und Kultureinrichtungen gefördert oder saniert werden sollen? Warum sprechen wir nicht viel häufiger über den enormen Wert, den Museen für unsere Gesellschaft – und für unsere gemeinsame Zukunft – haben?
Die kürzlich veröffentlichte Studie des Instituts für Museumsforschung liefert dafür belastbare Argumente. Sie zeigt, dass sich Investitionen in Museen auch ökonomisch lohnen. Die deutsche Museumslandschaft mit rund 7.000 Einrichtungen trägt jährlich über neun Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung bei. Öffentliche Zuschüsse flossen im selben Zeitraum in Höhe von 5,6 Milliarden Euro – jeder Euro davon generierte im Durchschnitt 1,70 Euro wirtschaftlichen Mehrwert. Berücksichtigt man zusätzlich die Ausgaben von Tourist:innen, die gezielt Museen besuchen – etwa für Anreise, Übernachtung oder Gastronomie – steigt dieser Effekt sogar auf 2,40 Euro pro investiertem Förder-Euro. Eine Zusammenfassung der Studie finden Sie hier.
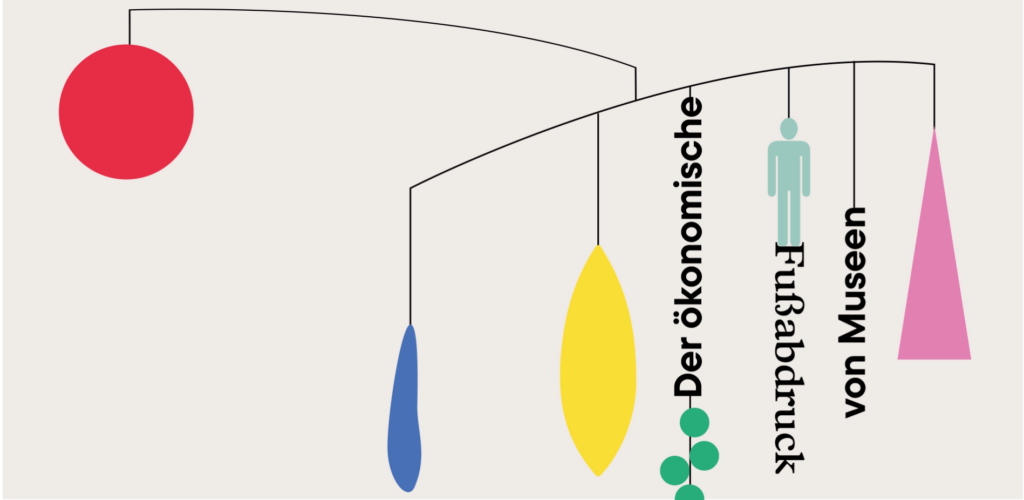 Besonders bemerkenswert: Von den öffentlichen Mitteln, die in Museen investiert wurden, flossen rund zwei Drittel direkt an die öffentliche Hand zurück – in Form von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen. Allein 2023 belief sich dieser Rückfluss auf 3,7 Milliarden Euro. Das macht deutlich: Öffentliche Investitionen in Museen wirken nicht nur kulturell und gesellschaftlich, sondern auch haushaltspolitisch als Rendite mit Rücklaufgarantie.
Besonders bemerkenswert: Von den öffentlichen Mitteln, die in Museen investiert wurden, flossen rund zwei Drittel direkt an die öffentliche Hand zurück – in Form von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen. Allein 2023 belief sich dieser Rückfluss auf 3,7 Milliarden Euro. Das macht deutlich: Öffentliche Investitionen in Museen wirken nicht nur kulturell und gesellschaftlich, sondern auch haushaltspolitisch als Rendite mit Rücklaufgarantie.
Gerade vor diesem Hintergrund wird deutlich, welche Hebelwirkung die öffentliche Hand auch im Bereich der nachhaltigen Beschaffung entfalten kann. Wenn Museen gezielt in energieeffiziente Gebäudetechnik, wiederverwendbare Ausstellungssysteme, lokale Dienstleister oder faire Materialien investieren, dann gehen diese Mittel nicht in den symbolischen Raum – sondern in konkrete, überprüfbare Wertschöpfungsketten. Der Staat kann hier durch gezielte Förderungen und Rahmenbedingungen nicht nur die ökologische Transformation unterstützen, sondern diese auch sozial gerecht gestalten. Und: Er verdient dabei sogar mit.
Doch der wahre Wert von Museen lässt sich nicht allein in Zahlen messen. Denn diese Häuser sind weit mehr als wirtschaftliche Multiplikatoren: Sie sind Speicher unseres kulturellen Gedächtnisses, offene Orte des Dialogs und nicht zuletzt Labore für Zukunftsfragen – insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit. Viele Museen in Deutschland haben bereits erkannt, dass sie eine besondere Verantwortung tragen, wenn es um Klimaschutz, Ressourcenschonung und soziale Gerechtigkeit geht. Und sie handeln.
Das Museum Ludwig in Köln beschäftigt eine eigene Kuratorin für Ökologie. Ausstellungen werden dort zunehmend so konzipiert, dass Materialien wiederverwendet werden können, Transportwege verringert und CO₂-intensive Praktiken vermieden werden. Das Archäologische Museum Hamburg spart durch die einfache Maßnahme, Thermostate auszutauschen, über 30 Prozent Heizenergie – und dadurch Geld. In Hamburg haben sich elf Museen zum Bündnis „Elf zu Null“ zusammengeschlossen, um gemeinsam Strategien für den ökologischen Umbau zu entwickeln – mit CO₂-Bilanzen, Fortbildungen, Pilotprojekten.
Diese Ansätze zeigen: Wer heute in Museen investiert, investiert nicht nur in Kultur, sondern in nachhaltige Infrastruktur, Bildungsgerechtigkeit und klimaschonendes Wirtschaften. Es geht dabei nicht um Prestigeprojekte oder „Luxus“ – es geht um zukunftsfähige Gesellschaftspolitik.
Dass diese Investitionen dennoch regelmäßig infrage gestellt werden, verweist auf ein Missverständnis: Kultur wird oft als freiwillige Leistung behandelt, während ihre systemische Bedeutung unterschätzt wird. Dabei sind Museen längst Akteur:innen der Nachhaltigkeit. Sie vermitteln nicht nur Wissen über Klimakrisen, Kolonialismus oder Ressourcenverbrauch – sie verändern aktiv ihre eigenen Strukturen. Und sie erreichen dabei ein Millionenpublikum.
Der Blick über den nationalen Tellerrand zeigt, dass es noch viel Potenzial gibt. In Ländern wie Australien, Dänemark, England oder Polen entstehen Museen, bei denen nachhaltige Architektur, zirkuläre Ausstellungsgestaltung und soziale Partizipation von Anfang an mitgedacht werden. Auch Deutschland braucht mehr solcher Leuchtturmprojekte – und das bedeutet auch: mehr Mut zur Investition.
Was also wäre, wenn wir die Frage von Patricia Rahemipour wirklich ernst nehmen würden? Wenn wir nicht reflexhaft Fördergelder für Kultureinrichtungen hinterfragen, sondern stattdessen diskutieren würden, wie Museen als öffentliche Orte noch wirksamer zur sozial-ökologischen Transformation beitragen können?
Dann müssten wir aufhören, Museen als Kostenstelle zu betrachten – und anfangen, sie als Teil der Lösung zu begreifen. Denn die wirklich wichtigen Dinge lassen sich nicht nur in Geld messen. Aber sie lassen sich finanzieren – wenn man bereit ist, in Zukunft zu investieren.